Als ich Freitagabend mit brüchiger innerer Maske im Zuschauerraum einer Wiener Vorstadtbühne saß und einer, die vor einem halben Jahrzehnt meine Welt aus den Angeln gehoben hatte, beim Fühlen zusah, breitete sich in einem kurzen Moment der Unachtsamkeit meiner always hustling Alltagspersona aus meiner Körpermitte schwarzer Samt in mir aus. Die pelzige Struktur des Gefühls erreichte in konzentrischen Kreisen zuerst den altbekannten Solarplexus und verteilte sich von dort bis in die äußersten Spitzen meiner Extremitäten. Es war der Schmerz über den Verlust von allem, das ich nach dieser damals erdrutschartigen Veränderung in meinem Leben so genossen und gefeiert hatte: die Verbindung zu mir selbst, zu meinem Leben, zu meinem Außen und zur Welt. Eine Verbindung, die nicht – wie damals – gut versteckt in einem zugemauerten Kämmerchen meiner Seele darauf wartete, wieder befreit zu werden, sondern eine Verbindung, die um zu Überleben mit einem harten, glatten Schnitt geteilt worden war. Chirurgisch getrennt und sachgemäß verödet, um das, was nötig war, um mein Überleben zu sichern, auch aushalten zu können.

Ich wusste, dass ich dieses Risiko einging aber ich wusste auch, dass ich keine reale Alternative hatte. Ich konnte wählen zwischen dem Schnitt mit der geringen Hoffnung, ihn eines Tages vernähen und heilen zu können, geduldig wartend, dass die Nervenenden einander wieder finden würden oder auch nicht und das Gefühl dann immer taub bleiben würde. Oder aber ich hätte die Verbindung offen gelassen und wäre damit nie hart genug geworden um zu gehen und den Kontaktabbruch aufrechtzuerhalten und mich aus der immerwährenden Spirale von Traumabonding und Retraumatisierung befreien zu können.

Da saß ich nun und fühlte in aller Tiefe, was ich sonst nie fühlen kann, weil es sie als Spiegel braucht um mich zu erinnern wie das geht (wieder). Und ich erinnere mich, was es ist und was es immer war um das es für mich geht, nämlich das, das Verbundensein, das Teilvonetwassein, das Bedeutungschaffen für mich und noch jemanden sonst. Und es tut weh, so unglaublich weh, weil ich das nicht sehen kann, nicht mehr wenn ich zurückschaue aber auch nicht wenn ich nach vorne schaue. Nicht so wie ich es kannte, nicht so wie ich es möchte, nicht so wie ich es brauche, weil da niemand ist, der es mit mir fühlt.
Dann spreche ich mit einer, die dafür jetzt zuständig ist darüber und sie fragt, ob ich mich an Momente erinnere, in denen ich das alleine konnte. Instinktiv antworte ich mit „nein“ und denke später noch einmal darüber nach und da stimmt das aber auch wieder nicht. Denn ich kenne sie, diese Momente, in denen ich gerade für mich bin und etwas sehe und es spüre und dann fotografiere ich es um es zu behalten und es auch später noch spüren zu können weil mein Kopf alleine so nicht funktioniert und dann schreibe ich etwas darüber und da spüre ich es in aller Tiefe weil ich es teile.
Doch diese Verbindungen und Teilungspunkte, die sind verflogen. Sie alle haben sich irgendwie verflüchtigt, durch den Algorithmus, durch Corona, durch die DSGVO und das damals sich langsam ankündigende und eruptiv passierende Sterben der belebten und weitgehend (kommerziell) absichtslosen Blogosphäre. Denn selbst, wenn es niemanden sonst gab, gab es diesen einen Lichtblick in RGB, diesen virtuellen Ort, an den ich immer nachhause kommen konnte und wo ich immer wusste, dass sich jemand zu mir in meinen virtuellen Schanigarten setzen und sich von meinen gefühlten Gedanken und den gedachten Gefühlen berühren lassen würde. Es war meine geheime Zuflucht, die mir keiner genommen hatte, weil sie ihre Bedeutung für mich gar nicht begreifen konnten. Ich war immer verbunden, durch die unsichtbare Energie, mit anderen da draußen die das gleiche Resonanzfeld suchten und das war sinnstiftend genug.

Und jetzt? Jetzt bin ich die geworden, die nicht mehr viel übrig hat für Sentimentalitäten und Wehmut über Dinge und Erinnerungen meines eigenen Lebens. So vieles hat sich im Innen neu bewertet und den rosa Schleier der Sentimentalität zerrissen. Es ist nicht mehr viel Weiches geblieben, nichts Entsättigtes, nur harte Kontraste und grelle Wahrheiten die mir wie scharf schneidende Erinnerungssplitter manche schmerzende Wunde zugefügt haben wenn ich über sie gestolpert bin.
Es ist die hier schon früher zitierte nietzscheanische Einsamkeit, dieses bodenlose Gefühl im hintersten Winkel irgendwo zwischen Herz und Seele in das man versucht Schönes und Wichtiges und Erfolgreiches zu kippen um es seichter zu machen, leichter zu machen doch es reicht nicht, es reicht nie, denn bis etwas Gutes den Grund erreicht ist es schon aufgebraucht und verpufft und man kann nie schnell genug nachleeren, es will nicht haften bleiben, es verschwindet als wäre es nie da gewesen.

Da sitze ich nun und sehe, wie viel Worte jemandem bedeuten können wenn sie an Erinnerungen haften, die Menschen miteinander verbinden. Wie die pelzige Struktur auch warm sein kann weil der Verlust vermischt ist mit Liebe und dann wird aus dem Schmerz die Melancholie und es ist etwas Schönes. Und ich will es so sehr, so unbedingt, mehr als alles andere und wieder einmal frage ich mich: wo ist mein Weg, der mich (wieder) dorthin bringt? Kann ich ihn noch finden? Gibt es ihn überhaupt noch, auf dieser kaputten Welt in der Worte ausgesprochen werden, die Menschen vor 80 Jahren geschworen hatten nie mehr zu dulden. Oder habe ich mich, haben wir uns so verirrt, dass diese Wege verschüttet sind und wir uns nur noch hintreiben lassen können in die immerwährend fortschreitende Taubheit der sich überlagenden Bilder des scrollenden Bildschirms?


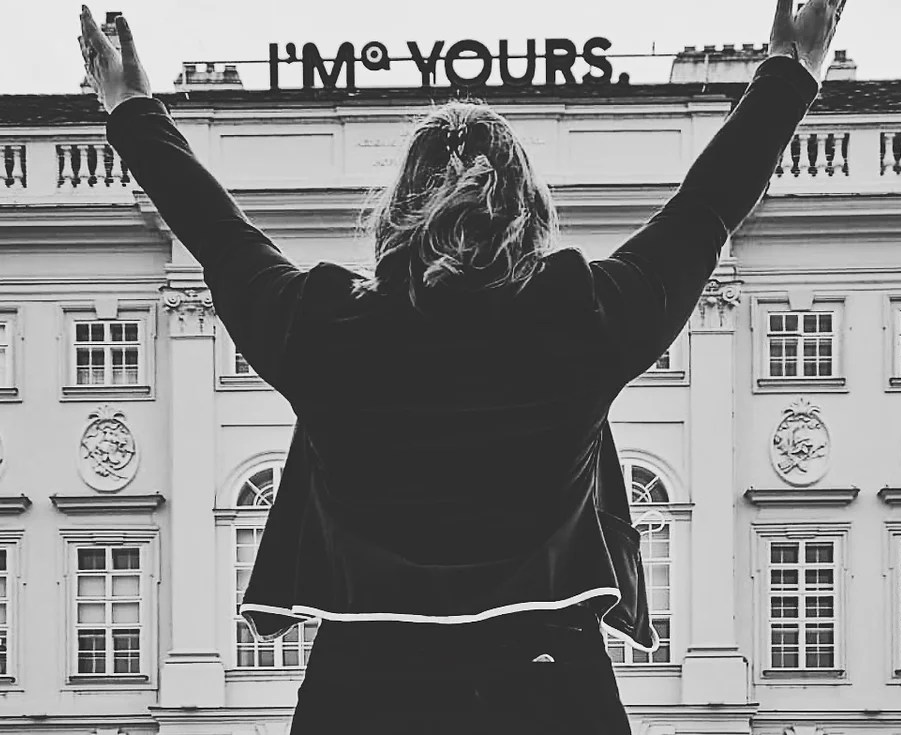

Hinterlasse einen Kommentar